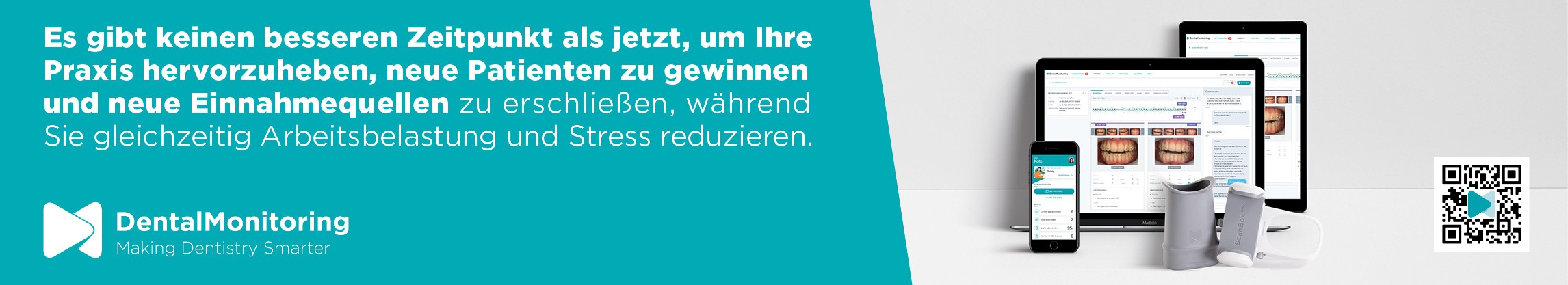KI in der KFO-Praxis: Zwischen Assistenzsystem und Zukunftsvision
Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Zukunftsversprechen – sie hält Einzug in die klinische Realität. Die IDS 2025 in Köln hat es deutlich gezeigt: KI-Technologien spielen eine zunehmend wichtige Rolle, auch in der Kieferorthopädie. Von der automatisierten Analyse von Fernröntgenseitenaufnahmen über die personalisierte Behandlungsplanung bis hin zur intelligenten Patientenkommunikation –
digitale Systeme unterstützen immer mehr Schritte im Praxisalltag. Ein zentraler Impulsgeber auf diesem Gebiet ist Prof. Dr. Falk Schwendicke, MDPH. Als Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie am LMU Klinikum München – und zuvor an
der Charité Berlin als Leiter der Klinik für Orale Diagnostik, digitale Zahnheilkunde und Versorgungsforschung – verbindet er fundierte klinische Erfahrung mit Innovations- und Versorgungskompetenz. Seine Forschung zur Anwendung von KI in der Zahnmedizin hat international große Beachtung gefunden. Im Gespräch mit Dr. Aneta Pecanov-Schröder, Zahnärztin und Fachjournalistin, ordnet Prof. Schwendicke die aktuellen Entwicklungen ein: Was ist heute schon möglich? Welche Anwendungen sind praxistauglich? Und warum bleibt trotz aller Automatisierung der Mensch die wichtigste Instanz im digitalen Behandlungsprozess?
Herr Professor Schwendicke, welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) derzeit in der Zahnmedizin und speziell in der kieferorthopädischen Praxis?
Prof. Schwendicke: KI hat in den vergangenen zehn Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen und ist mittlerweile fester Bestandteil der Zahnmedizin bzw. Kieferorthopädie. Der Anfang lag im Bereich der Bildanalyse, zunächst in der Dermatologie und Ophthalmologie, später auch in der Zahnmedizin. Seit etwa sechs bis sieben Jahren gibt es Studien, die zeigen, wie KI vor allem Röntgenbilder, Fotos und Scans analysieren kann. Mithilfe von Deep Learning lassen sich Karies, apikale Läsionen und Parodontitis erkennen. In der Kieferorthopädie werden cephalometrische Bilder automatisch vermessen, Landmarken gesetzt und Wachstumstypen bestimmt. Auch Modelle können automatisiert ausgewertet werden, was früher manuell erfolgte. Besonders bei der Aligner-Therapie ist die KI mittlerweile in die digitale Planung und teilweise automatisierte Durchführung integriert.
Sind Kieferorthopäden bei der Nutzung von KI besonders weit fortgeschritten, zum Beispiel durch Systeme wie DentalMonitoring?
Prof. Schwendicke: Durchaus, insbesondere in der Aligner-Therapie sind Kieferorthopäden sehr weit in der Anwendung von KI. Dieser Bereich war schon früh digital ausgerichtet – mit dem Einsatz von Intraoralscannern und digitalen Modellen. Da Aligner-Behandlungen oft lange dauern, bestand früh ein großes Interesse daran, den Therapieverlauf möglichst genau vorhersagen zu können, ohne ständig manuell eingreifen zu müssen. Systeme wie DentalMonitoring oder Invisalign nutzen seit mehreren Jahren KI-gestützte Auswertungen von intraoralen Fotos, die Patienten eigenständig zu Hause anfertigen. Die KI analysiert automatisch den Fortschritt. Auch in der Therapieplanung kommen zunehmend KI-Algorithmen zum Einsatz, um z. B. Zahnbewegungen zu simulieren und das Behandlungsergebnis vorab zu prognostizieren.
Sie gehören zu den Gründungsvätern von dentalXrai, ein Unternehmen, das auf die Entwicklung von KI-gestützter Software zur Röntgenanalyse spezialisiert ist. Wie ist man bei der Entwicklung dieser KI-Anwendung vorgegangen?
Prof. Schwendicke: Zu Beginn konzentrierte sich dentalXrai, wie viele andere Systeme auch, auf klassische zahnärztliche Bildgebung wie Einzelaufnahmen, Bitewings oder Panoramaschichtaufnahmen. Dass Fernröntgenseitenbilder (FRS) nicht im Fokus waren, lag auch daran, dass der FRS-Bereich zunächst nur von sehr wenigen Anbietern besetzt wurde. Inzwischen dringen aber auch größere Hersteller, insbesondere aus den USA, in diesen Markt vor – mit Lösungen wie DentliQ.ortho, Web-Ceph, AudaxCeph oder CephX.
Das klingt nach besonderen Herausforderungen für eine Automatisierung bei Fernröntgenseitenanalysen. Ist der Eindruck richtig und worin liegt die Schwierigkeit?
Prof. Schwendicke: Das stimmt. Ein zentrales Problem bei Fernröntgenseitenanalysen (FRS) in der Kieferorthopädie liegt in der uneinheitlichen Landmarken-Definition. Diese basiert historisch auf verschiedenen Referenzsystemen und Lehrmeinungen. Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden lernen das Setzen der Punkte sehr unterschiedlich – und das erschwert die Entwicklung und den Einsatz standardisierter KI-Systeme. Dennoch hat sich die Technik in den letzten Jahren deutlich verbessert: Moderne Tools erkennen
viele Landmarken inzwischen mit hoher Präzision und Anfangsschwierigkeiten konnten weitgehend überwunden werden. Markt und Technologie sind heute so weit gereift, dass Preis, Handhabung und Nutzerakzeptanz eine breite Anwendung ermöglichen – auch wenn die Abbildung individueller Vorgehensweisen weiterhin eine Herausforderung bleibt.
Worin liegt der größte Nutzen von Künstlicher Intelligenz für Zahnmediziner, und wo sehen Sie aktuell noch Hürden?
Prof. Schwendicke: Der größte Nutzen liegt aktuell in den zwei technologischen Bereichen Bildanalytik und Sprachverarbeitung. In der Bildanalytik profitieren wir von KI-gestützter Diagnostik, verständlicher Patientenkommunikation durch anschauliche Visualisierungen und automatisierter Befunddokumentation. In der Sprachverarbeitung unterstützen Chatbots oder Assistenzen die Praxisorganisation – etwa bei Terminvergabe oder Dokumentation im Patientengespräch, zum Beispiel durch Mitschreiben der Befunde und Generierung
von Arztbriefen. Die größten Hürden sind derzeit die Integration in bestehende Abläufe, Datenschutzfragen und die Bereitschaft, Verantwortung mit einem System zu teilen, dem man noch nicht voll vertraut.
Welches sind denn heute klassische Applikationen
von KI in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie?
Prof. Schwendicke: Zu den etablierten Einsatzbereichen Künstlicher Intelligenz zählen insbesondere die Bildanalyse von Röntgenaufnahmen – etwa zur Erkennung von Karies, Parodontitis oder apikalen Läsionen –, inzwischen auch automatisierte
cephalometrische Auswertungen bei FRSBildern zur Bestimmung von Wachstumstypen oder Zahnachsen sowie die virtuelle Behandlungsplanung bei Aligner-Therapien inklusive Ergebnissimulation. Darüber hinaus kommen KI-gestützte Systeme auch im Praxismanagement zum Einsatz, etwa für Terminvergabe oder Patientenkommunikation durch smarte Chatbots oder Recall-Funktionen.
Diese Anwendungen entlasten das Praxisteam, sparen Zeit und erhöhen die Präzision der Versorgung. Ein konkretes kieferorthopädisches Alltagsbeispiel ist die automatisierte Verlaufskontrolle bei Aligner-Therapien, wie schon angesprochen. Patienten scannen regelmäßig ihr Gebiss mit dem Smartphone über entsprechende Systeme. Die KI erkennt, ob die Aligner richtig sitzen, ob Zähne wie geplant wandern oder ob es Abweichungen gibt, ohne dass der Patient dafür in die Praxis kommen muss.
Im Zusammenhang mit KI in der (Zahn)Medizin kommt der Begriff „Halluzination“ vor. Was ist darunter zu verstehen?
Prof. Schwendicke: Halluzination bezeichnet den Fall, dass ein KI-System falsche oder erfundene Informationen generiert, die auf den ersten Blick korrekt wirken. In der Zahnmedizin kann das etwa eine Diagnose sein, die sich nicht aus dem Bildmaterial ableiten lässt, oder ein gesetzter Referenzpunkt, der anatomisch gar nicht existiert. Solche Fehler entstehen meist, wenn die Trainingsdaten lückenhaft sind oder die KI in unbekannten Situationen agiert. Deshalb bleiben menschliche Kontrolle, Transparenz und Qualitätsprüfung unverzichtbar.
Wie gehe ich in der Praxis mit KI-Systemen um, insbesondere wenn diese sehr selbstsicher wirken, und wie kann ich potenzielle Falschaussagen erkennen?
Prof. Schwendicke: Auch wenn KI-Systeme oft sehr überzeugend und selbstbewusst auftreten, bleibt die Verantwortung immer beim behandelnden Zahnarzt oder Kieferorthopäden. Man darf der KI nicht blind vertrauen – ähnlich wie bei einem Navigationssystem, das auch nicht immer den besten Weg kennt. Gerade in der Diagnostik kann es zu Fehlern kommen, etwa durch falsch-positive oder falsch-negative Befunde. Die KI kann Dinge detektieren, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind – oder umgekehrt etwas übersehen. Deshalb ist es entscheidend, dass der menschliche Experte die Ergebnisse überprüft, interpretiert und mit seiner eigenen Erfahrung abgleicht. KI ist ein hilfreiches Werkzeug, aber kein Ersatz für Fachwissen und kritisches Denken. Der Schlüssel liegt darin, KI-Ergebnisse als Unterstützung zu nutzen, aber sie immer durch das eigene Urteil zu validieren.
KI ist ein hilfreiches Werkzeug. Besteht die Gefahr, dass Zahnärzte oder Kieferorthopäden durch KI-Systeme ersetzt werden – oder ist die Sorge unbegründet?
Prof. Schwendicke: Die Sorge, durch einen „KIKollegen“ ersetzt zu werden, ist zurzeit unbegründet. KI-Systeme in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie sind ausschließlich als Assistenzsysteme konzipiert – sie unterstützen Behandlerinnen und Behandler, ersetzen sie aber nicht. Der oft zitierte Spruch „Die KI wird nicht den Radiologen ersetzen, aber der Radiologe mit KI wird den Radiologen ohne KI ersetzen“ lässt sich sehr gut auf Zahnärzte und Kieferorthopäden übertragen: In Zukunft wird es vielmehr auf eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine hinauslaufen. Der klinische Erfolg liegt in der Kombination aus ärztlicher Erfahrung, Empathie und kritischem Denken – ergänzt durch die analytische Stärke und Rechenleistung der KI. Statt Angst zu haben, geht es also darum, offen für neue Werkzeuge zu sein, um die eigene Arbeit präziser, effizienter und patientenorientierter zu gestalten.
Haben Sie Tipps, wie Kolleginnen und Kollegen aus der Kieferorthopädie lernen können, KI-Assistenzsysteme richtig zu beurteilen? Worauf sollten sie bei der Auswahl achten und wann ist Vorsicht geboten?
Prof. Schwendicke: Ja, es gibt einige ganz praktische Tipps – vor allem geht es darum, sich mit dem Thema bewusst und informiert auseinanderzusetzen, auch ohne tiefes Technikverständnis. Ein guter Einstieg ist die Checkliste der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), die im November 2023 [1] veröffentlicht wurde. Diese enthält wichtige Hinweise zu Rechtsrahmen, Berufsrecht und zur Auswahl geeigneter Systeme. Ich war an der Erstellung beteiligt – und kann sie auch Kolleginnen und Kollegen in der KFO wärmstens empfehlen. Darüber hinaus rate ich: Informieren Sie sich aktiv – durch Fachartikel, Kongresse, Vorträge oder Webinare zu KI in der Zahnmedizin. Unsere Arbeitsgruppe bei der WHO hat ein kompaktes „Core Curriculum“ [2] für KI in der Zahnmedizin entwickelt. Es umfasst nur wenige
Unterrichtseinheiten, vermittelt aber das nötige Basiswissen, um kritische Fragen an Hersteller stellen zu können. Typische Fragen an Anbieter könnten sein:
Wie wurde das KI-Modell trainiert?
Wurde es mit zahnmedizinischen Daten validiert – und wenn ja, mit welchen?
Gibt es Studien zur Genauigkeit oder Fehlerquote?
Wie transparent ist das System? Kann ich die Entscheidungsgrundlagen nachvollziehen?
Welche Rolle spielt der Behandler im Prozess? (Bleibe ich „in control“?)
Wie wird mit Datenschutz und Datenspeicherung umgegangen?
Wichtig ist: Man muss die Verantwortung behalten und sollte bei überzogenen Versprechungen oder fehlender Transparenz hellhörig werden. Wer sich bewusst wie bei der Auswahl anderer medizinischer Produkte informiert – z. B. wie bei einem neuen Adhäsivsystem –, kann KI-Tools sinnvoll und sicher einsetzen.
Gibt es aktuell empfehlenswerte Tools für die FRS-Analyse, und worauf sollte man bei der Auswahl besonders achten?
Prof. Schwendicke: Eine konkrete Empfehlung für ein bestimmtes Tool möchte ich nicht aussprechen. Das hängt stark von den individuellen Anforderungen der Praxis ab. Wichtig ist, dass jede Kollegin und jeder Kollege selbst prüft, welches System zur eigenen Arbeitsweise passt. Entscheidend bei der Auswahl eines KI-Tools, insbesondere für die FRS-Analyse, sind vor allem folgende
Fragen:
1. Woher stammen die Trainingsdaten? Das ist eine der zentralen Fragen. Wurde das System z. B. mit Daten aus Europa, Nordamerika
oder Ostasien trainiert? Ethnische Unterschiede, verwendete Bildgebungssysteme und der allgemeine dentalmedizinische Kontext (z. B. Karieshäufigkeit, Anzahl an Restaurationen) können die Leistungsfähigkeit der KI beeinflussen.
2. Ist der Datensatz repräsentativ für meine Patientenpopulation? Wenn Ihre Praxis primär mit europäischen Patienten arbeitet, ist ein Modell, das ausschließlich auf asiatischen Datensätzen basiert, möglicherweise nicht optimal abgestimmt – insbesondere in der Feindiagnostik.
3. Wie gut funktioniert das System mit meinen vorhandenen Daten? Stimmen Bildqualität, Gerätekompatibilität und Datenformate mit dem überein, was das Tool erwartet? Gibt es eine Testphase oder eine Möglichkeit, das System im Praxisalltag zu evaluieren?
Die wichtigste Erkenntnis: Nicht jedes KI-System passt zu jeder Praxis. Ein kritischer Blick auf die Herkunft und Eignung der Daten ist daher essenziell, um verlässliche und sichere Ergebnisse zu erzielen.
Was ist beim Einsatz von KI in der Kieferorthopädie datenschutzrechtlich zu beachten?
Prof. Schwendicke: Datenschutz bei KI unterscheidet sich kaum von anderen digitalen Anwendungen. Wichtig sind: eine gültige Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter, die informierte Einwilligung der Patienten – inklusive Hinweis auf den KI-Einsatz gemäß EU AI Act (2024) [3] sowie eine transparente Aufklärung. Außerdem sollten Behandler und Team nachweislich geschult
sein. Die Datenverarbeitung sollte zudem innerhalb der EU erfolgen, das sieht die DSGVO vor. Mit guter Aufklärung, solider Dokumentation und einem verlässlichen Hersteller sind KI-Tools datenschutzrechtlich gut und sicher in der Praxis integrierbar – wie andere digitale Systeme auch.
Welche KI-Anwendungen zur Analyse von Röntgenbildern sind im Jahr 2025 bereits praxistauglich, insbesondere für die Kieferorthopädie?
Prof. Schwendicke: Tatsächlich ist in den letzten Jahren viel passiert. Wir sehen heute eine zunehmende Praxistauglichkeit bei der automatisierten Analyse von Röntgenbildern wie Einzelzahnbilder, Bissflügelaufnahmen und OPGs. Diese Bilder werden zuverlässig genutzt zur Karieserkennung, Detektion apikaler Läsionen oder parodontaler Veränderungen – und das teilweise mit einer Qualität
und Geschwindigkeit, die auch im hektischen Praxisalltag echten Mehrwert bietet.
Wie bewerten Sie die Entwicklung der KI für FRS-Analysen in der Kieferorthopädie hinsichtlich Praxistauglichkeit?
Prof. Schwendicke: Die FRS-Analyse ist im KI-Bereich ein Spezialfall. Die Entwicklung ist hier im Vergleich zu anderen Anwendungen etwas langsamer vorangeschritten, da die Landmarken-Setzung stark variiert, je nach Methode oder Schule, wie ich weiter oben ausgeführt habe. Unterschiedliche Standards erschwerten lange eine einheitliche KI-Umsetzung. Auch war die Marktakzeptanz über längere Zeit ein Problem. Doch das ändert sich: Immer mehr Anbieter (wie WebCeph, AudaxCeph, CephX etc.) entwickeln robuste Algorithmen und die Akzeptanz wächst. Bei der FRS-Analyse sind wir inzwischen an einem Punkt, an dem viele Landmarken laut Studien sehr verlässlich erkannt werden. Einige wenige Punkte bleiben auch für den Menschen schwierig – dort zeigt die KI ebenfalls noch Schwächen. Aber insgesamt sind diese Tools heute bereits eine wertvolle Unterstützung für die Kieferorthopädie. Meine Prognose: Die automatisierte
FRS-Analyse steht kurz vor dem Durchbruch. Ich erwarte, dass sich KI-gestützte FRS-Analysen in den nächsten ein bis zwei Jahren als Standard etablieren – sofern die Systeme benutzerfreundlich, wirtschaftlich und gut integrierbar sind.
„Wir müssen Komplexität aus der Sache herausnehmen und die KI so bauen, dass sie für den Anwender klare Outputs generiert“, sagen Sie. Können Sie mit Beispielen veranschaulichen, was das heißt?
Prof. Schwendicke: Das ist ein ganz zentraler Punkt! KI darf nicht komplizierter sein als der klinische Alltag. Sie soll uns Arbeit abnehmen, nicht zusätzliche Fragen aufwerfen. Ein Beispiel ist die Kariesdiagnostik: Schon heute markieren gute Systeme verdächtige Stellen direkt im Bild (etwa mit einer roten Umrandung). Das hilft dem Zahnarzt, gezielt zu prüfen – ohne dass die Entscheidung aus der
Hand genommen wird. Die KI darf nicht alles markieren, was irgendwie „komisch“ aussieht (bedeutet hohe Sensitivität, aber viele Fehlalarme), sondern muss auch eine gewisse Spezifität einhalten – also nicht überdiagnostizieren. Hier helfen Trainings mit großen, gut kuratierten Datensätzen – und ein iteratives Feintuning des Algorithmus. Bei der FRS-Analyse geht es nicht um „Ja oder Nein“, sondern um exakte Punkte im Bild – z. B. Sella, Nasion, A-Pogonion usw. Früher lagen KI-basierte Landmark-Erkennungen in der FRS-Analyse oft 2 bis 4 mm vom Referenzwert entfernt, ein Bereich, der klinisch kaum verwertbar war. Heute erreichen moderne Systeme bei vielen Punkten eine Abweichung von unter 1 mm, teils sogar unter 0,5 mm. Bei besonders schwierigen Referenzpunkten wie Gonion oder Porion, die auch manuell mit größerer Varianz gesetzt werden, sind kleinere Abweichungen jedoch nicht automatisch als Nachteil zu werten. Entscheidend ist, dass die KI solche Unsicherheiten transparent macht, zum Beispiel durch Konfidenzangaben oder visuelle Prüfoptionen. Denn genau diese Transparenz erlaubt eine gezielte Überprüfung, und das ist ein wesentlicher Vorteil.
Fazit: Die Balance zwischen Sensitivität (alles Wichtige erkennen) und Spezifität (nicht zu viel Falsches markieren) ist keine rein mathematische Aufgabe, sondern eine Frage der klinischen Relevanz und Nutzerführung. Wir müssen Systeme bauen, die nicht nur genau sind, sondern auch verständlich und pragmatisch – und dabei immer die Interpretationshoheit beim Anwender lassen.
Wie wird ein solches Analyse-Tool für die Auswertung überhaupt aufgebaut?
Prof. Schwendicke: Dahinter stecken zwei zentrale Bausteine. Erstens: der Algorithmus selbst. Der wird trainiert, indem Expertinnen und Experten zum Beispiel bei OPGs bestimmte Strukturen oder Pathologien markieren – etwa Karies. Zum Beispiel setzen fünf unabhängige Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre Einschätzungen, daraus entsteht ein „Goldstandard“, den die KI nutzt, um ihre eigenen Vorhersagen zu vergleichen und sich Schritt für Schritt zu verbessern. Das geschieht mit Tausenden, außerhalb der Medizin oft mit Millionen von Bildern. Der zweite Baustein ist die Softwareoberfläche: Eine Umgebung, in der die KI leben kann. Hier interagiert die Nutzerin mit dem System, kann Bilder hochladen, navigieren, exportieren – eben ein Tool, das in den Praxisalltag passt.
Apropos „passt“: Viele Praxisteams fühlen sich vom Thema KI überfordert. Wie groß sind die Hürden in der Realität? Wie kann man digitale Kompetenz gezielt fördern?
Prof. Schwendicke: Die Hürden sind da – aber sie sind überwindbar. Die größte Hürde ist oft: „Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.“ Aber das Thema wird nicht verschwinden. Im Gegenteil: In drei bis fünf Jahren wird KI in der Zahnmedizin zum Standard gehören. Wer sie dann nicht nutzt, muss womöglich erklären, warum. Deshalb plädiere ich sehr dafür, sich jetzt damit vertraut zu machen – nicht technisch tiefgreifend, aber so, dass man fundiert beurteilen kann, was ein Tool kann und was nicht. Es gibt gute Einstiegsangebote:
Webinare, Fortbildungen, und das Core Curriculum [2] der WHO, das wir entwickelt haben. Es umfasst drei bis vier Lehreinheiten à 45 Minuten – das reicht oft schon, um ein solides Grundverständnis zu bekommen. Wir haben das Thema in München bereits ins Studium integriert – als Einführungsvorlesung und bald als Wahlpflichtfach. Denn: Digitale Kompetenz gehört heute zur zahnärztlichen Kernkompetenz. Und wir sollten Prozesse aktiv mitgestalten – nicht abwarten.
Wie lauten Ihre Empfehlung und zentrale Botschaft für Kolleginnen und Kollegen?
Prof. Schwendicke: KI wird ein fester Bestandteil unserer klinischen Realität werden. Aber sie ersetzt nicht unsere Erfahrung, unser Urteilsvermögen, unser Verantwortungsbewusstsein. Es geht nicht darum, blind auf Tools zu vertrauen – sondern darum, sie kompetent zu hinterfragen und sinnvoll zu nutzen. Wir als Zahnmediziner müssen die Technologie mitgestalten – nicht nur anwenden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich einzubringen. Denn in wenigen Jahren könnte es eher erklärungsbedürftig sein, keine KI im Praxisalltag zu verwenden. Deshalb mein Rat: Machen Sie sich mit den Möglichkeiten vertraut. Bleiben Sie offen, aber auch kritisch. Wenn Ihnen jemand ein System verkaufen will, stellen Sie die richtigen Fragen. Und: Bleiben Sie die Pilotin oder der Pilot im Cockpit Ihrer Praxis – nicht der Beifahrer.
Vielen Dank für die Einordnung und Ihre spannenden Einblicke!