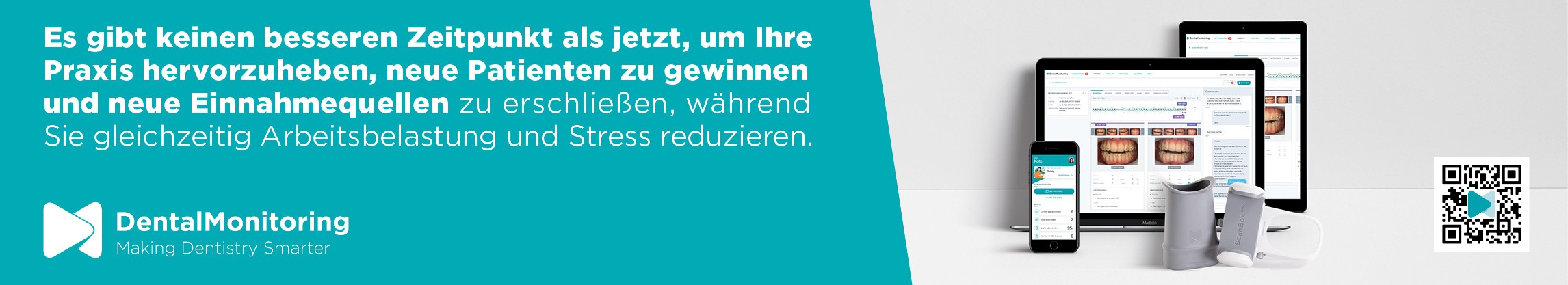Motiva(k)tion – lernen wie man loslässt
Einblicke in die systemische Kieferorthopädie
Dyskinesien und sog. Habits wie Daumenlutschen, Zähneknirschen, Wangenbeißen, Zungenpressen, Störungen der Zungenmotorik, Bleistiftkauen uvm. sind ungünstige Verhaltensweisen, die Auswirkungen auf den orofazialen Bereich haben und z. B. Zahnfehlstellungen auf vertikaler, transversaler und sagittaler Ebene verursachen können. Auch myofunktionelle Störungen sind häufige Begleiter. Dr. med. dent. Hubertus von Treuenfels aus Eutin entwickelte mit seiner systemischen Kieferorthopädie und Motopädie das sog. Therapie-Tandem, ein Konzept, das kieferorthopädische Geräte mit speziellen Übungen nach Padovan kombiniert. Auch aus eigener Erfahrung in der Kindheit weiß er darüber hinaus, dass Menschen in vielen Fällen über ein nicht unerhebliches eigenes Potenzial verfügen, sich selbst den entscheidenden Heilungsanstoß zu geben. So begegnet er seinen Patienten auf Augenhöhe und hat sie als Ganzes im Blick – über
die klassische symptomatische kieferorthopädische Behandlung hinaus. Im Gespräch mit Dr. Aneta Pecanov-Schröder und Kathrin Schuldt veranschaulicht er seinen therapeutischen Ansatz und gibt Tipps für den Praxisalltag.
Herr Dr. von Treuenfels, welche orofazialen Habits (und ihre Begleiterscheinungen) beobachten Sie in der Praxisroutine am häufigsten?
Dr. von Treuenfels: Ich sehe im Praxisalltag z.B.oft das klassische Beispiel des daumenlutschenden Kindes. Es nuckelt genüsslich-süchtig an seinem Daumen. Gemeinhin gilt diese Gewohnheit – wie andere Habits auch – als unerwünschte und unangemessene Verhaltensweise. Aber man sollte auch die Perspektive des Kindes miteinbeziehen, denn in seinen Augen bedeutet der Daumen das Gegenteil: Er ist willkommen und wird u. U. sehnlichst erwünscht, um zu beruhigen, ähnlich wie ein Schnuller, der auch Beruhigungssauger genannt wird. So wird das Daumenlutschen z.B. nach der anstrengenden Schule und zum Runterkommen gebraucht oder weil man traurig ist und darin etwas Trost findet. Das trifft auch auf die hier beschriebene Patientin zu, die eine kieferorthopädische Behandlung mit viel Zuwendung benötigte.
Sie meinen, Habits sollten nicht isoliert als zahnmedizinischer oder kieferorthopädischer Fall betrachtet werden…
Dr. von Treuenfels: Genau, denn diese Patientenfälle sind nicht nur systemisch und therapeutisch interessant, sondern vor allen Dingen menschlich. Dieser Aspekt interessiert mich sehr. Denn meiner Erfahrung nach ist der Austausch, das Gespräch mit dem Menschen als Grundlage für eine erfolgreiche Therapie besonders wichtig. Dabei stelle ich mich auf eine Stufe mit dem kleinen Patienten, höre ihm aufmerksam zu und gebe ihm zu verstehen, dass das Nuckeln nichts Schlimmes ist. Denn er erlebt ja das Gegenteil: Ihm tut das Daumenlutschen gut, wenn er sich z.B. einsam fühlt, ihn keiner sieht, achtet oder ernst nimmt. Also schaue ich gern mit der therapeutischen Empathie-Brille auf das Kind: Denn irgendwann hat es diese Möglichkeit der oralen Befriedigung, einer sinnlichen Betätigung, entdeckt. Und es macht durchaus Sinn – ein praktisches Trostpflaster immer zur Hand zu haben.
Demnach reagiert sich das daumenlutschende Kind an sich selbst ab. Lässt sich dieser Aspekt auch auf andere orofaziale Habits übertragen?
Dr. von Treuenfels: Der Mund eignet sich als ideale Bühne für allerlei nervöse bis neurotische Spielarten. So lassen sich auch andere sog. „schlechte Gewohnheiten“ (früher: Unarten) verhaltenspsychologisch deuten, z.B. Nägelkauen, Zähne- oder Zungenpressen, Zähneknirschen, Wangen- und Lippensaugen bzw. -beißen u.v.m. Manchmal erkennen wir schon von außen, was innen vor sich geht, wenn sich jemand gedanklich und emotional an etwas festgebissen hat, seine Zahnreihen verriegelt, nicht mehr loslassen kann. Man kann förmlich an Problemen herumkauen, sich an etwas (und dabei sich selbst) reiben, indem man seine Zähne aneinander reibt. Manch einer beißt eben lieber auf die Lippe statt eine Lippe zu riskieren und den Mund aufzumachen. So beißt sich der eine sprichwörtlich und eben auch tatsächlich durch, während sich ein anderer zähneknirschend geschlagen gibt…
Ist es möglich, dass eine fachübergreifende Interpretation der orofazialen Habits die Kompetenz des Zahnarztes oder Kieferorthopäden übersteigt?
Dr. von Treuenfels: Das ist individuell, würde ich sagen. Es kommt ganz auf den Behandler und den Patienten an und grundsätzlich gehören Ärger und Ängste zum täglichen Leben. Wer gut zuhören kann, dem wird manchmal Erstaunliches erzählt – dafür wird erstmal kein Psychologe benötigt. Häufig entscheiden wir in der Praxis erst im Verlauf der Behandlung, ob wir zu einer psychotherapeutischen Begleittherapie raten. Manchmal wird sie ohnehin schon in Anspruch genommen.
Aber weil sich konfliktreiche Lebenssituationen in unserem Fachgebiet manifestieren können, geht es uns als Zahnärzte und Kieferorthopäden eben auch etwas an. Unsere Behandlung kann sich nämlich auch positiv auf die Psyche auswirken, allein schon durch die Linderung von Verspannungen und Schmerzen. Studien zufolge können zusätzliche Heileffekte entstehen, sobald sich Patienten wahrgenommen und verstanden fühlen.
Wieviel erreicht man mit der konventionellen Schienentherapie bei Patienten mit bestimmten orofazialen Habits?
Dr. von Treuenfels: Je nach Fall, mal mehr, mal weniger. Aufbissschienen schützen zwar die Zahnsubstanz und ggf. die Kiefergelenke vor dem Knirschen. Ähnlich lässt sich auch durch den Entzug des Fingers oder Schnullers das Lutschen verhindern und damit mögliche daraus resultierende Kieferverformungen bis hin zu einem offenen oder Rück-Biss. Die verborgenen Gründe hinter diesem Verhalten aber, die sich oft aus einer Not oder Bedürftigkeit heraus auf körperlicher Ebene als Dysfunktionen (mit oder ohne Schäden) zu erkennen geben, erreichen wir damit nicht. Nicht selten beschäftigen und bedrücken bestimmte Themen die Betroffenen so intensiv und beständig, dass sie aus ihrem Verhaltensmuster, einer psycho-somatischen Endlosschleife, ohne fremde Hilfe kaum mehr herauskommen. Gerade vor zwei Tagen brach eine Mutter vor mir in Tränen aus, weil sie ihre Tochter nicht vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann schützen konnte. Sie stellte sich wegen akuter Kiefergelenksschmerzen in unserer Praxis vor.
Sie arbeiten auf dem Gebiet der systemischen Kieferorthopädie: Worin unterscheidet sich Ihr Therapieansatz von herkömmlichen Herangehensweisen?
Dr. von Treuenfels: Durch ein dynamisches Therapie-Tandem. Als erste Maßnahme setze ich bewegliche Schienen, z.B. eine Bissorthese wie den Biognathor ein. Weil dieser nicht an den Zähnen befestigt ist, sondern lose die Bewegungen zwischen Unter- und Oberkiefer vermittelt und führt und dabei nur wenige Punktkontakte zulässt, unterlässt der Patient unweigerlich das Knirschen und Pressen. Durch diesen Loslass-Effekt entspannt er und kann sich selbst von seinen Schmerzen, Gelenkbeschwerden, dem Knacken, den Blockaden usw. befreien.
Wie lässt sich erklären, dass der Patient sich offenbar selbsttätig von seinen Schmerzen, Beschwerden etc. befreit?
Dr. von Treuenfels: Eine zentrale Frage! Dieses reflexhafte Loslassen beruht auf der sog. reziproken Innervation antagonistischer Muskeln, die einst Prof. Charles Scott Sherrington, ein britischer Neurophysiologe, entdeckte und u.a. dafür den Nobelpreis erhielt. Vereinfacht gesagt, stoppt und schaltet das Kausystem augenblicklich um, sobald ein bedrohliches Signal durch einen Fremdkörper zwischen den Zähnen gemeldet wird. Und das kann leicht geschehen, z.B. wenn wir beim Essen plötzlich auf ein Steinchen oder einen Kirschkern beißen.
So wird der Loslass-Effekt auch durch den punktuellen Kontakt mit der Bissorthese ausgelöst…
Dr. von Treuenfels: Genau. Ähnlich wie ein Befehlsignal („Lass das!“) – und schon lässt auch der Schmerz nach. Dahinter steckt wiederum ein weiteres Phänomen: Ihm zufolge werden Symptome und ihr Verschwinden vom Organismus des Erkrankten selbst hervorgebracht bzw. erzeugt. Das haben die Wissenschaftler Humberto Maturan und Francisco Varela erforscht und es mit ihrem Theorem der Autopoiesis definiert. Dementsprechend sind wir selbst die Urheber unserer Krankheiten, je nach vorhandenen und veränderten Lebensbedingungen. Das gleiche gilt auch umgekehrt für unsere Gesundheit. Wir sind also selbst diejenigen, die sich krank und gesund machen, je nachdem, welchen positiven oder negativen Einflüssen wir ausgesetzt sind.
Können Sie das bitte noch einmal genauer erläutern?
Dr. von Treuenfels: Gern, hier ein Bild dazu: Ein Bergsteiger droht abzustürzen und hält sich verzweifelt mit den Händen und zusätzlich mit den Zähnen am Seil fest. Äußerlich gesehen erst einmal ähnlich. Aber wir können auch unbewusst und unwillkürlich krampfhaft an etwas festhalten, uns festbeißen, mit einem unbedingten Willen, z.B. in der Prüfung nicht durchzufallen. Auch hier überanstrengen und strapazieren wir unsere Kiefermuskeln und Gelenke und gönnen ihnen keine Erholungspausen bis sie erschöpft sind und schmerzen. Da wir es selbst verursacht haben, liegt die Lösung primär bei uns. Sie heißt loslassen, lockern. Und das geht nur über die Bewegung, über den Wechsel von An- und Entspannung. Denn in einem Muskel wie dem Masseter oder M. temporalis, den wir unter Stress, besonders über Nacht, über längere Zeit an- und selten entspannen, erzeugen wir Verhärtungen wie den Hartspann, Verkürzungen, Verdickungen, Steifheit und Schmerzen. Ein gesundes Muskelleben sieht anders aus: Arbeit und Freizeit, Kontraktion und Relaxation müssen sich im wahrsten Sinne des Wortes ablösen.
Wie erreichen Sie diese Entspannung im Zuge Ihres Therapie-Tandem-Ansatzes?
Dr. von Treuenfels: Der Einsatz von Schienen bzw. Orthesen wird durch weitere Therapiemaßnahmen wie Übungen für die Muskelmotorik von Mund und Körper ergänzt. Denn vor allem bei
hartnäckigen Beschwerden reichen oft Schienen oder Bissorthesen allein nicht aus. Deshalb verschreiben Zahnärzte betroffenen Patienten oft zusätzliche Therapien wie Physiotherapie, Osteopathie, Massagen…
Delegieren Sie diese Zusatzmaßnahmen oder legen Sie hier selbst Hand an?
Dr. von Treuenfels: Beides. Wenn der Patient eine Verschreibung wünscht oder bereits zum Therapeuten geht, soll es mir recht sein. Es gibt aber Vorteile, wenn ich beides, d. h. Schiene und Co-Therapie, zusammen durchführe. So bleibt es in (m)einer Hand und man bewegt sich buchstäblich und verlässlich im selben Therapiekonzept. Das schätzen die meisten Patienten. Es bringt aber noch weitere Vorteile mit sich: Wir ersparen ihnen nicht nur einen weiteren Therapeuten mit zusätzlicher Anlaufadresse, sondern ständige Wiederholungen der gleichen
Behandlung. Dazu ein Beispiel: Auf meine Frage, warum Patient X trotz Schiene und Physiotherapie meine Behandlung wünscht, höre ich oft die Gegenfrage: „Wie lange und wie viele Schienen soll ich noch zerkauen und wie häufig soll ich noch zur Therapie fahren?“ Wenn ich dann frage, ob es überhaupt hilft, kommt oft ein ähnlicher Kommentar: „Am Anfang ja, besonders die Osteopathie. Aber allmählich schleicht sich die alte Misere, das mühselige Muster, wieder ein.“ Die Patienten werden das Gefühl nicht los, das Übel nicht wirklich überwunden zu haben.
Sind das die Patienten, die für Ihre Art der Behandlung am ehesten bereit sind?
Dr. von Treuenfels: Das ist genau der Punkt, denn Leidensdruck führt zur Motiva(k)tion. Das „K“ darin steht für Kompetenz und kennzeichnet meine Übungstherapie. Während sich der Patient z.B. beim Physiotherapeuten oder Osteopathen überwiegend passiv verhält und etwas gemacht bekommt, mache ich ihn in meinem Therapiekonzept selbst zum Akteur. Diese sog. Selbstwirksamkeit erspart ihm Termine, Fahrtwege, Wartezimmer- und Behandlungszeiten und Mehrkosten. Nichtsdestotrotz brauche und schätze ich die osteopathische und physiotherapeutische Co-Therapie sehr.
Das klingt plausibel, erfordert aber sicherlich eine ebenso spezielle Kompetenz des Behandlers…
Dr. von Treuenfels: In der Tat. Ich behandle nicht nur (kiefer-)orthopädisch (s. Abb. 10 und 11), sondern auch motopädisch – mit dem gemeinsamen Nenner „pädisch“ (griech. Paideia „Pädagogik, Erziehung“). Mit der Orthese, der Schiene, „erziehe“ und lenke ich den Kiefer und seine Gelenke orthopädisch in die richtige (ortho=gerade) Haltung und Stellung. Motopädisch begleite ich den Schienen/Ortheseneinsatz mit Übungen und „erziehe“ die Mundbewegungen durch Einüben der physiologischen
Motorik.
Wie und nach welcher Methode leiten Sie Ihre Patienten zu den Übungen an?
Dr. von Treuenfels: Ich arbeite nach der Padovan-Methode mit dem Ziel der „neurofunktionellen Reorganisation“. Was das heißt, lässt sich an einem typischen Beispiel veranschaulichen: Ein stressgeplagter Patient reibt und presst seine Zähne ständig zusammen bis es knirscht. Dieser Bruxismus ist eine Parafunktion des Kauens. Wer so auf seinen Zähnen kaut, diese u. U. zerkaut, braucht, um aus diesem schädlich-schmerzhaften Muster herauszukommen, eine Rückführung, eine Re-Organisation seines Kausystems, weg von der Dysfunktion und hin zur Orthofunktion. Dazu bringen wir, bildlich gesprochen, seine abwegigen Kieferbewegungen auf den richtigen (geraden) Weg. Neurofunktionelle Reorganisation heißt also, dass wir über die Funktion und Verschaltung der Nervenbahnen die unerwünschte nicht physiologische Kaufunktion (z.B. Knirschen) umorganisieren, bis sie das normale Kaumuster wiedererlernt.
Dann arbeiten Sie als Coach und Trainer, indem Sie Patienten etwas beibringen, das ihnen hilft, selbst aus den Fehlerfallen herauszufinden. Sie sind eine Art Mundtrainer…
Dr. von Treuenfels: So könnte man es nennen. Und so erkläre ich es auch gerne den Patienten: Sie sind Spieler, ich der Trainer. Sie wollen das beinah verlorene Spiel noch retten und gewinnen. Sie engagieren mich als Coach (Motopäde), der sie zunächst mit mund- und ggf. auch mit körpermotorischen Übungen wieder betriebs- bzw. bewegungstauglich macht. Damit können sie ihr Problem (z.B. den Zwist mit dem Vorgesetzten) besser bewältigen, sich unbeschadet da durchbeißen – ohne sich daran die Zähne auszubeißen.
Mund und Zähne eignen sich offenbar besonders für sprichwörtliche Vergleiche…
Dr. von Treuenfels: Ich liebe sie, in vielen stecken Volksweisheiten. Therapeutisch kommt es darauf an, belastende, beängstigende oder gar bedrohliche Gedanken und Gefühle so abzuarbeiten, dass sie im Körper, im Muskelgewebe, an den Zähnen, Knochen und Gelenken möglichst keine Beschwerden oder Schäden erzeugen. Um nicht im Pressen und Knirschen zu entgleisen und darin zu verharren, stellt die Bissorthese wie eine Schiene die Weiche.
Über diesen Ausweg nimmt der festgefahrene Kiefer neue Fahrt auf und bewegt sich wieder auf normale und natürliche Weise. Das lässt sich auch auf alle anderen Dys- und Parafunktionen übertragen. Der Patient übt, reorganisiert und erinnert sich an seine angestammten gesunden Bewegungsmuster: Dabei folgen wir dem physiologischen Schema: Erstens geht der angestrebten Entspannung eine kurze Anspannung voraus. Zweitens wird ein angemessener leichter Widerstand aufgebaut, an dem sich die Muskeln abarbeiten können. Drittens arbeiten alle Muskeln orthofunktionell, d.h. ihr Zusammenspiel wird so koordiniert und synchronisiert wie bei einer gesunden Mundfunktion.
Demnach muss der Behandler das gesunde Schema kennen bzw. wissen, was anatomisch und physiologisch kohärent ist.
Dr. von Treuenfels: Durchaus. Und das bedeutet, dass wir nicht das Schlechte oder Falsche bekämpfen, sondern das vorhandene Gute vervollständigen, indem wir das physiologisch Richtige einüben. Die Beschwerden, die Symptome, werden nicht unterdrückt, sondern verschwinden, weil sie überflüssig werden. Bildlich gesprochen: Wenn ich einer aufgebrachten Dampfmaschine einen Prellbock entgegenstelle, bringe ich sie zwar zum Stehen, ihr wutschnaubendes Gehabe und Gestampfe lässt sich damit aber nicht besänftigen. Viel sinnvoller ist es deshalb, diese an sich ja positive Bewegungsenergie gewinnbringend ein- und umzusetzen. Ihre Power prallt dann nicht mehr auf den Prellbock und der Ärger verpufft.
Das erinnert an den Bilderbuchklassiker „Henriette Bimmelbahn“ von James Krüss…
Dr. von Treuenfels: Das stimmt. Oder auch an Friedrich Felds Geschichte „Lok 1414 geht auf Urlaub“. In beiden Werken kommt es darauf an, sich von Zwängen zu befreien, sich frei zu bewegen, also naturgemäß – so wie wir es im täglichen Leben brauchen. Tatsächlich werden bestimmte Glückshormone erst durch Bewegung in Umlauf gebracht. Und weil wir mit unserer Selbstwirksamkeit selbstbewusster und unabhängiger werden, überkommt uns damit ein erhabenes Gefühl der Leichtigkeit.
Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Arbeit, Herr Dr. von Treuenfels.
Ein Beitrag von Dr. Aneta Pecanov-Schröder, Bonn und Kathrin Schuldt, Hamburg