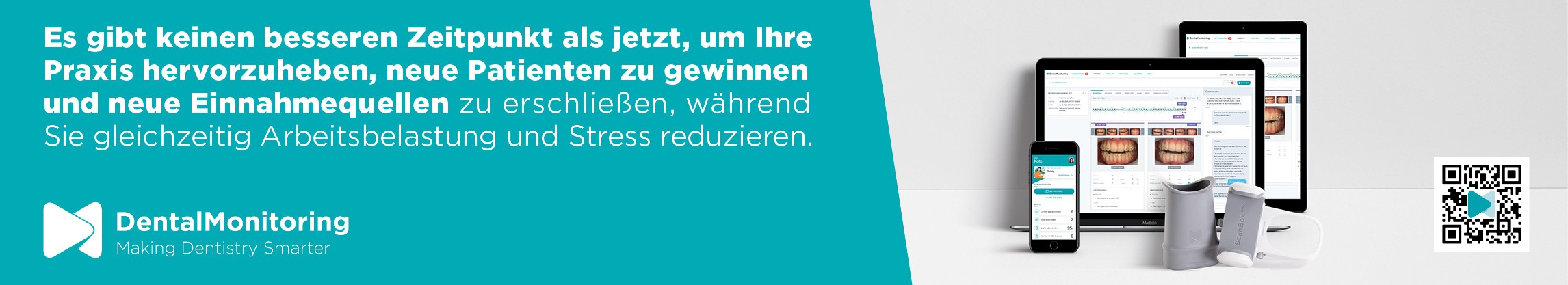Zwischen Fortschritt und Vertrauensfrage
Wie KI das Arzt-Patienten-Verhältnis beeinflusst
Radiologische Befundungen, digitale Planungstools oder administrative Assistenzsysteme sind längst mehr als Zukunftsmusik. Doch während Ärztinnen und Ärzte die Potenziale von KI vielfach schätzen, zeigt die öffentliche Wahrnehmung eine andere Seite: Skepsis, Zurückhaltung und ein mögliches Vertrauensproblem. Eine aktuelle Studie aus Würzburg und Berlin, veröffentlicht im JAMA Network Open, liefert hierzu aufschlussreiche Daten, die auch für den Praxisalltag in der Kieferorthopädie von hoher Relevanz sind.
Aufbau und Ergebnisse der Studie
Das Forscherteam um Moritz und Florian Reis untersuchte, wie Patientinnen und Patienten Ärztinnen und Ärzte bewerten, wenn diese angeben, KI in ihrer Arbeit einzusetzen. Grundlage war ein Online-Experiment mit 1.276 Erwachsenen in den USA. Die Teilnehmenden sahen fiktive Werbeanzeigen von Hausärzten, die sich lediglich in einem Punkt unterschieden: Während in der Kontrollgruppe nichts über KI erwähnt wurde, gaben die übrigen Anzeigen an, dass der Arzt KI entweder für administrative, diagnostische oder therapeutische Zwecke nutzt.
Die Bewertung erfolgte anhand von vier Dimensionen:
- Kompetenz
- Vertrauenswürdigkeit
- Empathie
- Bereitschaft, einen Termin zu vereinbaren
Das Ergebnis war eindeutig: In allen Fällen, in denen ein KI-Einsatz erwähnt wurde, schnitten die Ärztinnen und Ärzte signifikant schlechter ab. Sie wurden als weniger kompetent, weniger empathisch und weniger vertrauenswürdig wahrgenommen. Entsprechend sank auch die Bereitschaft der Befragten, einen Termin zu vereinbaren. Auffällig war zudem, dass der Unterschied nicht nur bei diagnostischen oder therapeutischen Anwendungen sichtbar wurde, sondern selbst dann, wenn KI ausschließlich für administrative Zwecke genutzt wurde.
Interpretation:
Ein Vertrauensdilemma
Die Ergebnisse zeigen ein zentrales Dilemma moderner Medizin: Was die Versorgungsqualität steigern kann, wird von Patientinnen und Patienten zunächst mit Skepsis betrachtet.
Mögliche Gründe sind vielfältig: Sorge, dass Ärztinnen und Ärzte der KI blind vertrauen könnten. Angst vor weniger persönlicher Zuwendung im Behandlungsalltag. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Kostensteigerungen.
Die Wissenschaftler betonen, dass selbst kleine Einschränkungen im Vertrauen langfristig bedeutsame Auswirkungen haben können. Schließlich gilt die Arzt-Patienten-Beziehung als einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Behandlungen – ein Befund, der durch zahlreiche Metaanalysen untermauert ist.
Relevanz für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie
Auch in der Zahnmedizin schreitet der Einsatz von KI rasch voran. Von der automatisierten Analyse kieferorthopädischer Röntgenbilder bis hin zur digitalen Behandlungsplanung oder Terminverwaltung – KI wird in den kommenden Jahren vielerorts zum Praxisalltag gehören. Gerade hier, wo Behandlungserfolg stark von langfristiger Compliance und einem stabilen Vertrauensverhältnis abhängt, darf die Kluft zwischen technologischem Fortschritt und Patientensicht nicht übersehen werden.
Die Studie legt nahe: Nicht die Technologie selbst ist das Problem, sondern die Art, wie sie kommuniziert wird. Für die Kieferorthopädie ergeben sich daraus mehrere praxisnahe Handlungsempfehlungen:
- Transparenz schaffen: Patientinnen und Patienten sollten verstehen, warum KI eingesetzt wird – etwa um Verwaltungsaufwand zu reduzieren und damit mehr Zeit für persönliche Gespräche zu gewinnen.
- Nutzen hervorheben: Gerade in der Diagnostik kann KI die Präzision erhöhen und Ärztinnen und Ärzte entlasten. Wichtig ist, dies als Unterstützung, nicht als Ersatz der ärztlichen Expertise darzustellen.
- Empathie betonen: Der persönliche Kontakt bleibt das Herzstück der Behandlung. KI darf nie den Eindruck erwecken, menschliche Zuwendung zu verdrängen.
- Teamkommunikation stärken: Auch das Praxispersonal sollte geschult sein, den KI-Einsatz zu erklären und mögliche Sorgen zu entkräften.
Ausblick
Die Untersuchung von Reis et al. verdeutlicht, dass KI in der Medizin nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kommunikative Herausforderung ist. Für Ärztinnen, Ärzte und Praxisteams bedeutet dies: Der Einsatz digitaler Werkzeuge muss begleitet sein von klarer, patientenzentrierter Kommunikation. Nur so lässt sich verhindern, dass ein wertvolles Instrument unbeabsichtigt das Vertrauen schwächt, das für jede erfolgreiche Behandlung unverzichtbar ist.
Gerade in der Kieferorthopädie, wo Patientinnen und Patienten oft über Jahre hinweg betreut werden, ist diese Botschaft zentral: Technologie darf den menschlichen Kern der Behandlung nicht überstrahlen, sondern sollte ihn stärken. Weiterführende Informationen und den vollständigen Artikel finden Sie unter www.jamanetwork.com mit dem Titel „Public Perception of Physicians Who Use Artificial Intelligence“